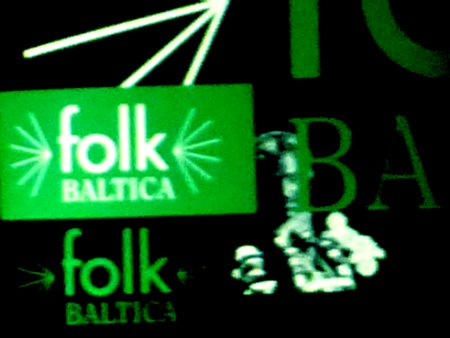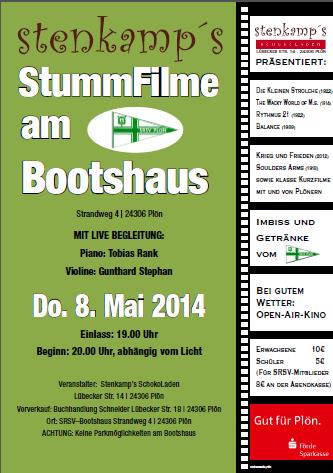Schwerpunktthema Hipperstraße.
Der Ausbau der Hipperstraße bewegt im Moment die Gemüter und beschäftigt die Ausschüsse.
Dabei sind zwei Themenkomplexe zu unterscheiden. Die Gestaltung und das liebe Geld.
In der Sitzung des SteU am Mittwoch wurde von der ursprünglich beschlossenen Tagesordnung abgewichen, um den zahlreichen Anwohnern/-Innen und Eigentümern/-Innen die Möglichkeit zu geben, Ihre Fragen nach der Erläuterung der Verwaltungsvorlage zu stellen. Daher wurde der Tagesordnungspunkt Einwohnerfragestunde nach den Ausführungen der Verwaltung, aber vor der Beschlußfassung des Ausschusses zum Thema Hipperstraße eingeschoben.
Ich finde dieses Verfahren gut, da den Einwohnern und Einwohnerinnen die Möglichkeit gegeben wurde, sich gewissermaßen an der Diskussion zu beteiligen. Ich hätte mir ein ähnliches Verfahren bei den Seewiesen gewünscht. Dabei fand ich es auch völlig in Ordnung, daß sich hier auch Eigentümer an der Diskussion beteiligen konnten, die keine Plöner Bürger sind. Da der Ausschußvorsitzende versäumt hat zu fragen, ob die fragenstellenden Personen damit einverstanden sind, daß ihre Namen im Protokoll erwähnt werden, werde ich es hier auch nicht tun.
Zurück zum Thema:
Im Laufe des Verfahrens wurde die Kritik laut, daß die Eigentümer erst sehr spät informiert wurden. Das ist wohl zutreffend, allerdings besteht dazu auch keine Verpflichtung. Dazu kommt, daß das Thema seit über einem Jahr in mehreren Sitzungen öffentlich behandelt wurde. Die Tagesordnungen und die Protokolle der Sitzungen konnten im Internet nachgelesen werden.
Hier befinden wir uns in einem Spannungsfeld, das gerne mit Push und Pull bezeichnet wird. Welche Informationen muß die Verwaltung den Bürgern aktiv zur Kenntnis geben, welcher Aufwand ist dafür vertretbar? In wie weit kann man erwarten, daß sich die Bürgerinnen und Bürger selber informieren? Werden die Aushänge am Rathaus gelesen? Werden die Amtlichen Bekanntmachungen in der Regionalpresse gelesen? Welche Rolle fällt dem Internet heute und möglicherweise zukünftig zu?
Das erste Hauptthema war die Form des Ausbaus. Kern der Problematik ist, daß die Gebäude auf der westliche Straßenseite über keine Stellplätze verfügen. Die Bewohner müssen also auf der Straße parken. Der Bau der Gebäude wurde zu einer Zeit genehmigt, als der Besitz eines Autos noch nicht üblich war. Daher wurden in den Genehmigungen auch keine Stellplätze für Autos gefordert. Die Genehmigungen sind nach wie vor gültig, nachträgliche Auflagen sind juristisch nicht möglich. Die Eigentümer, zwei Wohnungsbaugesellschaften sind aus steuerrechtlichen und betriebswirtschaftlichen Gründen nicht bereit, Stellplätze einzurichten.
Daher parken die Autos auf der westlichen Straßenseite. Da nun auch die Autos immer größer und breiter geworden sind, reicht die Straßenbreite nicht mehr aus. In Folge fahren nicht nur LKW mit einem Rad auf dem Bürgersteig auf der östlichen Straßenseite. Da der Bürgersteig nicht für solche Belastungen ausgelegt ist, befindet er sich in einem schlechten Zustand.
Die ursprünglich auch vom Ausschuß verfolgte Lösung, Flächen von den westlichen Straßenseite zu erwerben, um die Straße zu verbreitern, scheiterte an der Bereitschaft der Eigentümer, diese Flächen zu verkaufen. Ein Ankauf von Flächen auf der östliche Seite erwies sich als unpraktikabel, da hierdurch viele private Stellplätze, die direkt an den Bürgersteig heranreichen, wegfallen würden. Zudem wären hier die Interessen von über 20 Eigentümern unter einen Hut zu bringen, was sehr schwierig ist und einer schnellen Lösung entgegengestanden hätte.
Damit blieb als einzige Lösung, den östlichen Bürgersteig so robust auszulegen, daß er auch mit einem Rad, auch z.B. vom Müllwagen, befahren werden kann. Dabei wurde nach anfänglicher Diskussion entschieden, auf einen hohen Kantstein zu verzichten, weil dieser den Belastungen des ständigen Überfahrens nicht dauerhaft standhält.
Glücklich war niemand mit dieser Lösung, weder Verwaltung noch die Selbstverwaltung, und schon gar nicht die Anwohner und Anwohnerinnen sowie mehrere Eigentümer.
Auch wenn die Stimmung wohl emotional geladen war, kamen aus den Reihen der Anwohnerinnen und Anwohner bzw. der Eigentümer und Eigentümerinnen mehrere Vorschläge, die von den Ausschußmitgliedern beraten und von der Verwaltung sehr umfangreich und sorgfältig untersucht wurden.
Dabei erwies sich, daß der Fußweg mit einer hohen Bordsteinkante auf der westlichen Seite verbleiben muß, um die Sicherheit des Schulweges zur Breitenauschule zu gewährleisten. Zudem hätte der Bordstein auf der östlichen Seite wegen der vielen Ausfahrten und Stellplätze über weite Srecken abgesenkt werden müssen.
Die Anlage von Parkplätzen auf wechselnden Straßenseiten würde die Autofahrer dazu zwingen, vorsichtiger zu fahren. Um die Durchfahrt von Versorgungsfahrzeugen und der Feuerwehr zu gewährleisten, wären zum einen ausreichend große Abstände zwischen den Parkflächen erforderlich gewesen, zum anderen wären die Bürgersteige an beiden Straßenseiten so zu bauen gewesen, daß sie auch befahren werden können. Dies hätte zu Kostensteigerungen, aber vor allem zum Verlust von Parkplätzen geführt, was auch keiner will.
Die Einrichtung einer verkehrsberuhigten Zone ist nicht möglich, weil die Verkehrsaufsicht des Kreises dem nicht zustimmen wird. Dafür gibt es mehrere Gründe. Zum ersten ist das Verkehrsaufkommen zu groß, zum zweiten wird der hochbordige Bürgersteig auf der westlichen Seite für die Sicherheit der Kinder auf dem Schulweg benötigt und zur dritten widerspricht der Parkplatzbedarf diesem Lösungsansatz.
Wegen der Parkplatzsituation wurde auch der Vorschlag eines absoluten Halteverbotes verworfen. Dies hätte zu einer Verlagerung parkender Auto in die ebenfalls schon stark frequentierten angrenzenden Wohnbereiche geführt.
Eine Gewichtsbegrenzung für LKW, eine Umkehrung der Fahrtrichtung für die bestehende Einbahnstraße und eine Verbot, am Ende der Hipperstraße rechts abzubiegen, werden nicht umgesetzt, da diese Maßnahmen zu einer Verlagerung des Verkehrs in die Schillener Straße und zu zusätzlichen Belastungen in dem Bereich führen würden.
Das zweite Hauptthema war wieder das Geld. Nach Einschätzung der Verwaltung und auch der überwiegenden Mehrheit der Selbstverwaltung handelt es sich um eine Anwohnerstraße, auch wenn sie als Durchgangstraße für die angrenzenden Wohngebiete genutzt wird. Damit werden die Anwohner nach der alten Ausbausatzung 75 % der Kosten zu tragen haben, nach der neuen Ausbausatzung wären es sogar 85 %. Bei einer Kategorisierung als innerörtliche Verbindungsstraße wären es 10 % weniger. Ein Hauseigentümer führte aus, daß die zu erwartenden Kosten für ihn in keinem Verhältnis zum erwarteten Werterhalt oder Wertgewinn seiner Immobilie stehen würden. Seiner Forderung, den Hauseigentümern dann wenigstens entgegenzukommen und die Straße nicht als Anwohnerstraße zu Kategorisieren, damit es günstiger wird, erteilte der Ausschußvorsitzende eine klare und deutliche Absage.
Diese Abage ist aus meiner Sicht völlig berechtigt. Auch wenn ich mich der Auffassung, die die CDU im letzten Hauptausschuß geäußert hat, anschießen kann, nämlich über die Straßenbreite hinaus klare Kriterien für die Einordnung der Straßen festzulegen, wird die Hipperstraße niemals als innerörtliche Durchgangs- oder Verbindungsstraße eingestuft werden, weil sie als Einbahnstraße keinen Verkehr in beide Richtungen zuläßt.
Als nächstes werde ich über die Berichte berichten, bevor ich auf die übrigen Tagesordnungspunkte eingehe.