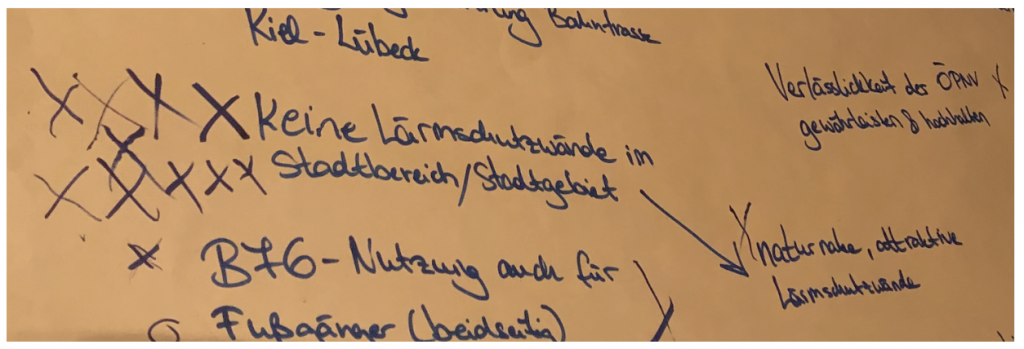Gestern, am 13. Dezember, fand die letzte Ratsversammlung im Jahr 2023 in der Messe in der MUS statt.
Mit 25 Tagesordnungspunkten hatten wir eine herausfordernde Sitzung zu bewältigen. Ziel war, die Sitzungsdauer so kurz wie möglich zu halten. Üblicherweise werden im Anschluss an die letzte Sitzung der Ratsversammlung noch ein paar Häppchen gereicht und etwas getrunken, um mit den anwesenden Bürger*innen ins Gespräch zu kommen und das politische Jahr damit ausklingen zu lassen. In diesem Jahr kamen die Gastgeber der Marineunteroffizierschule noch hinzu.
Ich habe im Ältestenrat zugestimmt, so zu verfahren. Es gab keine richtige Alternative dazu. Daher wurde für die meisten Tagesordnungspunkte vereinbart, ohne vorherige Aussprache zu beschließen. Allerdings fand ich das relativ unglücklich, denn es standen mehrere Punkte auf der Tagesordnung, die im Vorfeld vorher nicht in den Ausschüssen beraten wurden. Dabei ging es überwiegend um Gebührenfragen.
Da es 23 öffentliche und drei nicht-öffentliche Tagesordnungspunkte gab, will ich nur auf einige eingehen.
TOP 12 / Wirtschaftspläne der Stadtwerke Plön Anstalt öffentlichen Rechts (SWP AöR) und der Stadtwerke Plön Versorgungs GmbH (SWP GmbH).
Die SWP AöR sind für die Abwasserbeseitigung und den Bauhof, damit verbunden auch für die Straßenreinigung zuständig. Zudem gehört das Glasfasernetz zu ihrem Aufgabenfeld.
Die Stadt Plön ist an der SWP GmbH zu 70% beteiligt, die anderen 30% werden von den Stadtwerken Eutin gehalten. Zu ihrem Geschäftsfeld gehören die Vermarktung von Strom und Gas sowie die Vermarktung des Glasfaserangebotes.
Die SWP AöR sind ein Tochterunternehmen der Stadt. Die Ratsversammlung entsendet Mitglieder in den Verwaltungsrat der Stadtwerke AöR. Dort werden die grundsätzlichen Beschlüsse gefaßt. Seit einiger Zeit steht fest, dass die städtischen Gremien gegenüber den Mitgliedern, die von der Stadt in den Verwaltungsrat entsandt wurden, weisungsbefugt sind.
Vor dem Hintergrund fand ich den Vorlauf des Beschlusses „unglücklich“. Daher hatte ich in der Ältestenratssitzung angekündigt, dass ich zu dem TOP Aussprachebedarf sehe.
Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke wurde uns erstmals in der Sitzung des Hauptausschusses am 27. November 2023 vorgestellt. Es gab keine vorherige Information, so dass man sich nicht auf den Tagesordnungspunkt vorbereiten konnte. In der laufenden Sitzung ist eine gründliche Analyse nicht möglich. Somit war es nur theoretisch möglich, den Mitgliedern des Verwaltungsrates eine Weisung für die Sitzung des Verwaltungsrates am 07. Dezember 2023 (also nur 10 Tage später)
mit auf den Weg zu geben. Dort wurde der Wirtschaftsplan dann auch beschlossen.
Ich habe dem Wirtschaftsplan im Verwaltungsrat zugestimmt, da ich keine Fehler oder echten Gefahren erkannt habe. Dennoch kann das nicht der richtige Weg sein. Deshalb habe ich die Erwartung geäußert, dass wir im nächsten Jahr sowohl den Wirtschaftsplan wie auch die Stellungnahme des Beteiligungsmanagements der Verwaltung rechtzeitig vor der Sitzung des Hauptausschusses bekommen, damit im Vorfeld in den Fraktionen darüber gesprochen werden kann.
Das ist eigentlich die Voraussetzung, im Hauptausschuss sinnvoll über den Wirtschaftsplan zu beraten und ggf. Weisungen zu erarbeiten.
Erst danach ist es angebracht, im Verwaltungsrat zu entscheiden.
Eigentlich sah der Beschlussvorschlag vor, dass wir über die Kenntnisnahme entscheiden. Ich hatte in meinem Wortbeitrag angekündigt, dass die FWG-Fraktion sich enthalten wird, wohl wissend, das das bei einer Kenntnisnahme nur symbolischen Charakter hat. Allerdings wollten wir damit deutlich machen, dass das Verfahren – so wie es in diesem Jahr durchgeführt wurde – nicht mitgetragen wird.
Irgendwie kam es dann aber doch nicht zur Abstimmung. Wichtig ist mir, dass unsere Forderung im Protokoll auftaucht, so dass wir uns im Hebest 2024 darauf beziehen können und niemand behaupten kann, man hätte davon nichts gewußt.
TOP 13 / Abwassergebühren
Die Abwassergebühren werden steigen. Das die Abwasserentsorgung zur Daseinsvorsorge gehört und die Stadtwerke quasi ein Monopol haben, unterliegen sie besonderen Bedingungen und werden kontrolliert. Gebühren müssen kostendeckend sein, es dürfen aber keine Überschüsse erwirtschaftet werden. Werden dennoch Überschüsse erzielt, sind sie in der kommenden Abrechnungsperiode bei der Gebührenrechnung zu verrechnen. Sie werden quasi an den Kunden zurückgeben.
In der vorletzten Abrechnungsperiode wurden Überschüsse erzielt. Diese Überschüsse wurden in der letzten Abrechnungsperiode verrechnet. Die Gebühren sind gesunken. Jetzt sind die Überschüsse aufgebraucht. Die Gebühren werden für die erwartenden Kosten kalkuliert. Unter Berücksichtigung der zu erwartenden allgemeinen Kostensteigerungenwerden die Grundgebühren je nach Zählergröße um 25% angehoben, die Zusatzgebühr steigt um 9,17% von 3,38 € auf 3,69 € und die Gebühr für Regenwasser wird um 22,37% von 0,76 € auf 0,93 € pro Berechnungseinheit angehoben.
TOP 14 / Wassergebühren
Die Gebühren für die Wasserversorgung steigen ebenfalls. Die Grundgebühr wird um 2,82% angehoben, der Kubikmeterpreis steigt um 1,68% von 1,79 € auf 1,82 €
TOP 18 / Straßenreinigung
Die Straßenreinigungsgebühr berechnet sich nach den Frontmetern zur Straße. Sie steigt ab 2024 von 3,86 € pro Meter im Jahr auf 4,27 € .
TOP 19 / Tourismusabgabe
Viele Unternehmen in Plön müssen eine Tourismusabgabe zahlen. Die einen profitieren mehr, die anderen weniger von unseren Gästen. Bisher gilt der Realgrößenbezug als Grundlage für die Berechnung. Die Kommunalaufsicht hatte angeregt, zukünftig die Umsatzhöhe als Bemessungsgrundlage zu nutzen, weil diese Berechnung ein höheres Maß an Rechtssicherheit und Abgabengerechtigkeit gewährleistet. Bei der Umsetzung der Änderung hat sich aber gezeigt, dass damit ein höherer Verwaltungsaufwand verbunden ist. Gleichzeitig haben sich einzelne Berufsgruppen – ins besondere die Ärzteschaft – gegen die Umstellung gewehrt. Unter Berücksichtigung der neuen Information zum Aufwand für die Umstellung in Verbindung mit den Vorbehalten aus der Bürgerschaft wurde auf die Umstellung verzichtet, solange die Berechnung auf Basis der Realgrößen rechtlich noch zulässig ist.
Die Beschlüsse wurden bis dahin meist einstimmig – teilweise bei einer oder zwei Enthaltungen – oder mit einer Gegenstimme beschlossen. (Anm.: bei z.B. 15 Ja-Stimmen und einer Enthaltung gilt eine Entscheidung als einstimmig.)
Anders war es bei TOP 21 / Umsetzung Fahrradstraße Eutiner Straße.
Vorhergegangen war eine Abstimmung im Ausschuss für Stadtentwicklung und Planung. Dort gab es fünf Stimmen für und fünf Stimmen gegen die Umsetzung der Fahrradstraße. Da in der Sitzung ein Mitglied fehlte und es Vertretungen gab, konnte davon ausgegangen werden, dass das Abstimmungsergebnis nicht repräsentativ für das allgemeine Meinung in der Ratsversammlung ist.
Um hier eine erneute Abstimmug herbeizuführen, die die Mehrheitsmeinung widerspiegelt, hatte die SPD gleich im Anschluss an die Entscheidung beantragt, das Thema auf die Tagesordnung der Ratsversammlung zu setzen. In Rücksprache mit der Kommunalaufsicht wurde aber festgestellt, dass die Ratsversammlung aufgrund der Festsetzung der Verfahrensregeln in der Zuständigkeitsordnung und in der Hauptsatzung die Entscheidung des Ausschusses nicht überstimmen kann. Sie kann das Thema aber zur erneuten Beratung zurück in den Ausschuss verweisen. Alternativ wäre es möglich, dass eine Fraktion den Antrag erneut in den Ausschuss einbringt.
Der SPD ging es nun darum, den Ausschuss mit einer Mehrheit aus der Ratsversammlung heraus mit der erneuten Beratung zu beauftragen. Der CDU kam es darauf an, genau das zu verhindern. Sie schlug vor, dass die SPD den Antrag zurückzieht und einen neuen Antrag in den Ausschuss einbringt. Daraufhin wurde nicht in der Sache, aber über das Verfahren beraten. In der Abstimmung gab es dann mit 11 Ja bei fünf Nein-Stimmen eine klare Mehrheit in der Ratsversammlung, das Thema erneut im Ausschuss zu beraten.
Zu dem Thema gab es in unserer Fraktion (FWG) unterschiedliche Auffassungen. Da wir weder Fraktionszwang noch Fraktionsdisziplin kennen (was nicht heißt, dass wir in den Fraktionssitzungen nicht konzentriert, ernsthaft und diszipliniert arbeiten) und nach bestem Wissen und Gewissen entscheiden, stimmten Ratsherr Kruppa und ich für den Antrag, Ratsherr Gampert stimmte dagegen.
Der nichtöffentliche Teil der Sitzung wurde in Rekordzeit abgearbeitet, da für alle Punkte eine Abstimmung ohne Aussprache verabredet war.
Im Anschluss gab es dann sehr leckere Häppchen und auch das ein oder andere Getränk. Ich habe die Gelegenheit genutzt, um mich mit einem der Anwesenden Soldaten zu unterhalten. Wie sich im Laufe des Gespräches herausstelle, hatten wir als Ubootgahrer vor vielen Jahren schon einmal einen flüchtigen dienstlichen Kontakt.